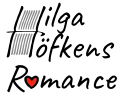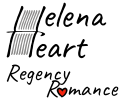Lady Sophia und die Schatten der Vergangenheit
gibt es als
Ebook und Taschenbuch.
signiertes Taschenbuch
kaufen
Ebook kaufen oder kostenlos lesen mit kindle unlimted
Eine lange Leseprobe findest du unten auf dieser Seite.

Baron Camerden ist auf den ersten Blick fasziniert von der zurückhaltenden Lady Sophia. Unerwartet hilft sie ihm aus einer prekären Situation und er erkennt, dass sie ebenso gegen die Schatten der Vergangenheit kämpft wie er selbst.
Die Erlebnisse in der Kriegsgefangenschaft lassen den Baron selbst ein Jahr nach seiner Rückkehr keinen Frieden finden. Doch welches Geheimnis verbirgt die junge Witwe Sophia, die man überall nur die »steinerne Lady« nennt?
Als Sophia durch die Machenschaften geldgieriger Geschäftsleute in Schwierigkeiten gerät, bietet der Baron seine Hilfe an. Doch die Dämonen der Vergangenheit ruhen nicht – Sophia wird entführt und Henry sieht sich alsbald einem grausamen Gegner gegenüber.
»Lady Sophia und die Schatten der Vergangenheit« ist der zweite Roman aus der Reihe »Great Northern Shipping«.
Leseprobe von "Lady Sophia und die Schatten der Vergangenheit"
Kapitel 1
London im Juni 1764
Immer wieder schlug er zu. Er konnte einfach nicht aufhören, und warum sollte er auch? Schweiß brannte in seinen Augen, doch er nahm sich nicht die Zeit, ihn wegzuwischen. Er hieb hart auf die französische Uniform ein, sprang vor und zurück, obwohl sein Gegner sich nicht wehrte.
Seine Knie zitterten vor Erschöpfung, doch erst als er seine Arme nicht mehr heben konnte, hielt er keuchend inne. Der Stock, der bei den Übungen den Degen ersetzte, glitt zu Boden und rollte gegen die ausgestopfte Attrappe, die seinen Feind darstellen sollte.
Henry schloss die Lider in der Hoffnung, dass endlich das Gesicht des französischen Offiziers vor seinem inneren Auge verschwinden würde und er wieder das formlose Stück Stoff der Übungspuppe sehen könnte, auf die er so unerbittlich eingeschlagen hatte.
Jedes Mal, wenn er bei seinen Übungen der Erschöpfung nahekam, kehrte die Erinnerung zurück und sie brachte die grausamen Geister mit, die ihn Tag und Nacht verfolgten.
Trotzdem musste er jeden Abend hier auf den Dachboden steigen und seine Fähigkeiten im Kampf trainieren. Es war ein Vorwand, denn nur wenn er sich vollständig verausgabte, war er schließlich erschöpft genug, um einzuschlafen.
Heute hatten ihn jedoch schon kurz nach Mittag die Bilder aus der Vergangenheit gequält und wie ein Verrückter war er nach oben gerannt. Den Seelenschmerz hinauszuschreien und wie von Sinnen auf die Übungspuppe einzuschlagen war immer noch besser, als an seinem Schreibtisch zu sitzen und mit zitternden Händen die Papiere zu ordnen, deren Inhalt er in diesem Zustand ohnehin nicht erfassen konnte.
Er schüttelte resigniert den Kopf, wischte den Schweiß mit dem weiten Ärmel seines Hemdes von der Stirn und sah noch ein letztes Mal auf die Übungspuppe, die aufrecht und unbeweglich an der Wand hing.
An einigen Stellen war der Stoff von der Wucht des Stockes aufgeplatzt und man konnte das Stroh sehen, mit dem sie gefüllt war. Die Sonne schien durch das kleine Fenster an der Giebelseite des Raumes und malte seltsame Flecken auf den Stofffetzen, der den Kopf der Figur formte. Sie grinste erhaben, sie war es, die immer noch stand, während er keuchend und vor Erschöpfung zitternd auf seine Knie gesunken war.
Nein, das bildete er sich wieder ein. Sein Geist hatte Schaden genommen in der Kriegsgefangenschaft und immer wieder sah er Dinge, die nicht wirklich waren.
Er zwang sich, den Blick abzuwenden, kämpfte sich auf die Füße und stolperte zur Tür. Auf dem Weg die schmale Stiege hinunter musste er sich am Geländer festhalten, denn noch immer fühlten seine Beine sich vor Müdigkeit weich an. Er hatte den Übungsraum ganz oben unter dem Dach eingerichtet, weil er hoffte, dass die Dienerschaft sein Gebrüll beim Training dort nicht hören würde, doch inzwischen wusste er es besser. Natürlich wussten sie inzwischen, was er dort tat, und natürlich redeten sie über seinen mangelhaften Geisteszustand. Die ganze Stadt tat das, und auch wenn es ihn nicht berühren sollte, was sie alle dachten, so erzeugte es doch ein erdrückendes Gefühl von Unzulänglichkeit.
Unten angekommen wandte er sich seinen Räumen zu, um ein Bad zu nehmen und den Staub und Schweiß abzuwaschen. Noch ehe er allerdings die Tür zu seinem Schlafzimmer erreichte, kam sein Kammerdiener Collins auf ihn zu und verneigte sich.
„Verzeihung, Mylord, der Earl lässt ausrichten, dass Sie ihn bitte umgehend aufsuchen mögen, sobald Sie – äh – wieder verfügbar sind.“
„Danke, Collins, ich werde nach meinem Bad verfügbar sein. Richten Sie dem Earl das aus und dann legen Sie meine Abendgarderobe zurecht, ich werde später noch ausgehen.“ Der Mann trat nicht wie erwartet zur Seite, sondern blieb mit einem zerknirschten Gesichtsausdruck stehen. „Nun, verzeihen Sie, aber der Earl sagte, dass Sie ihn sofort aufsuchen sollen, also sobald Sie von oben gekommen sind – er war recht deutlich.“
Henry konnte sich vorstellen, was mit „recht deutlich“ gemeint war. Wahrscheinlich hatte er den armen Collins wieder angeschrien und die ganze Wut, die eigentlich ihm als seinem Sohn galt, an dem Diener ausgelassen.
Henry legte wirklich keinen Wert auf eine Unterhaltung mit seinem Vater, besonders jetzt nicht, da er sich nach dem Kampf mit dem Phantom seines französischen Kerkermeisters viel zu angeschlagen fühlte.
Es hatte keinen Zweck. Wenn er nicht gehorchte, würde der alte Mann seinen Missmut nur weiter an der Dienerschaft auslassen. Also nickte er knapp, wandte sich um und schritt mit geballten Fäusten zur Bibliothek, in der sein Vater sich zu dieser Stunde aufzuhalten pflegte.
„Da bist du ja endlich. Komm her und versteck dich nicht bei der Tür“, erklang die dünne Stimme des Earls.
Einen Augenblick brauchten Henrys Augen, um sich an das Dämmerlicht zu gewöhnen. Die Vorhänge waren geschlossen und sperrten das Sonnenlicht aus, was der Bibliothek einen bedrohlichen Eindruck verlieh. Die deckenhohen Wände voller Bücher, die zum Teil uralt waren und von längst vergangenen Generationen von Berkshires angeschafft worden waren, verströmten diesen besonderen Geruch, der Bibliotheken zu eigen war. Außerdem war der Raum mit mehreren gepolsterten Sitzgruppen und dem obligatorischen Tisch mit alkoholischen Getränken ausgestattet.
Sein Vater saß wie immer am Schachtisch, den er direkt neben das Fenster hatte stellen lassen, und brütete über einer Partie, die er gegen sich selbst spielte. Hier war der Vorhang eine Winzigkeit geöffnet, sodass einzig die Figuren im einfallenden Sonnenlicht standen und regelrecht zu leuchten schienen.
Gehorsam trat Henry um den hohen Lehnsessel herum, in dem sein Vater klein und schmächtig wirkte.
Der Eindruck täuschte allerdings, wie er wusste. Denn auch wenn der Earl körperlich gebrechlich war, so waren sein scharfer Verstand und sein herrisches Wesen davon unbeeinträchtigt.
Henry verbeugte sich steif, denn sein Vater bestand auf traditionellen Umgangsformen, auch wenn es inzwischen völlig unüblich war, in den eigenen vier Wänden so formell zu sein.
„Guten Tag, Eure Lordschaft, Sie haben nach mir verlangt.“
Der Earl wedelte unwirsch mit der Hand, als wollte er eine Fliege verscheuchen. „Setz dich endlich, Junge. Ich kann nicht den ganzen Tag zu dir aufsehen.“
Sein Vater sprach ihn wie gewohnt nur als Junge an in der Absicht, den Abstand zwischen ihnen zu verdeutlichen. Er war für ihn nicht einmal der Bezeichnung Sohn oder seines Vornamens würdig.
Mit einem hörbaren Seufzer ließ Henry sich auf einem eleganten geschnitzten Stuhl gegenüber des Sessels nieder.
„So geht das nicht weiter mit dir“, eröffnete der Earl seine übliche Tirade. „Da bist du aus dem Krieg zurückgekehrt, als wir schon gar nicht mehr damit gerechnet haben. Nun bist du also wieder der Erbe. Dein Bruder hat nichts Besseres zu tun, als unseren Ruf mit ungebührlichem Benehmen endgültig zu ruinieren.“ Er stützte die Hand auf die Armlehne des Sessels und schob sich nach vorn. Eindringlich bohrte sich sein Blick in Henrys Gesicht, als wollte er ihn aufspießen wie ein Insekt, das man zum Präparieren an ein Brett heftete. Mit scharfem Ton fuhr er fort: „Er trinkt, bis er nicht mehr gehen kann, und spielt um mehr Geld, als ihm zusteht. Schon zweimal musste ich für seine Spielschulden eintreten, obwohl er eigentlich von seinen regelmäßigen Zuwendungen reichlich übrig behalten müsste.“
Henry nickte. Er wusste das alles längst und würde nun – wie üblich – für die Fehler seines Bruders zur Rechenschaft gezogen zu werden. Schweigend wartete er ab.
„Wenn du nicht zurückgekommen wärst, würde das alles nicht passieren. Gerald war auf einem guten Weg, mein Nachfolger zu werden. Er hatte begonnen, Verantwortung zu übernehmen und die Familie in der Gesellschaft angemessen zu repräsentieren. Erst dein Auftauchen hat ihn völlig aus der Bahn geworfen. Du hast ihn in diese Situation gebracht. Du hast ihm ja praktisch sein Erbe weggenommen.“
„Was?“ Mehr als dieses eine Wort brachte er angesichts der Ungeheuerlichkeit der Vorwürfe nicht heraus. War es nun sogar sein Fehler, dass er die grausame Gefangenschaft in Frankreich überlebt hatte und überhaupt nach Hause zurückgekehrt war? Wäre es seiner Familie lieber gewesen, es wäre anders gekommen?
Er ballte die Fäuste und atmete mehrmals verkrampft ein und aus, während der Earl weiterredete.
„Und nun wirst du dem Familiennamen ja auch nicht gerecht. Du solltest dich in der Gesellschaft sehen lassen, uns auf Bällen und im Theater repräsentieren und dir um Himmels willen endlich eine Ehegattin suchen. Stattdessen …“
Henry sprang auf und begann vor dem Lehnsessel des Earls auf und ab zu gehen. „Vater – Eure Lordschaft – Sie wissen, dass das nicht so einfach ist. Ich ertrage viele Menschen nicht. Ich kann nicht wie früher … ich habe … ich habe diese … Anfälle.“ Seine zusammengekrampften Fäuste zitterten. „Sie wissen das. Ich mache mich zum Gespött, wenn das in Gesellschaft geschieht. Ich habe es versucht.“
Warum konnte der Earl ihn nicht einfach in Ruhe lassen? Es war schon schwer genug, die inneren Dämonen unter Kontrolle zu halten, ohne dass Menschenmengen, laute Geräusche und unvorhergesehene Rempler ihn aus dem inneren Gleichgewicht brachten. Kleine, ruhige Dinnereinladungen mit wenigen Gästen hatte er schon erfolgreich hinter sich gebracht, aber einen Ball oder ein Theater zu besuchen – das war völlig außerhalb seiner Möglichkeiten.
„Nun fängst du wieder davon an. Das ist ja das Problem mit dir, Junge. Ein wenig Disziplin werden sie dir beim Militär doch beigebracht haben? Du musst dich zusammenreißen. So schwer kann das doch nicht sein.“ Der Earl war lauter geworden und seine Stimme klirrte schrill wie der Klang von Säbeln, die gegeneinanderprallten. „Sie nennen dich den verrückten Sohn von Berkshire! Sie lachen über unsere Familie.“ Er klopfte mit seinem Zeigefinger so heftig auf den Schachtisch, dass der weiße König umfiel und unbeholfen über das Holz rollte. „Du musst dem Einhalt gebieten. Du musst ihnen beweisen, dass alles in Ordnung ist.“
Inzwischen zitterte Henry am ganzen Körper vor unterdrückter Wut und weil das Geschrei des Earls wieder diesen Drang auslöste, zu fliehen.
Er wollte laufen. Lange und so weit, wie ihn seine Glieder tragen konnten. So, wie er es nachts oft tat, wenn er aus seinen Träumen hochfuhr und an Schlaf nicht mehr zu denken war.
Er zwang sich dazu, vor dem Sessel seines Vaters stehen zu bleiben und den schmalen alten Mann anzusehen. „Es ist aber nicht alles in Ordnung, Eure Lordschaft, und das wissen Sie. Die Erinnerungen sind so … Sie waren nicht dort, Sie können das nicht verstehen.“ Seine Stimme war immer leiser geworden. Er wollte nicht mehr darüber sprechen, er wollte nur noch fort aus diesem Raum, der ihn plötzlich so sehr einengte, fort von seinem Vater und von seinem ganzen Leben.
Aber so weit würde er niemals laufen können, dass er vor sich selbst fliehen könnte.
„Nein, Junge, das werde ich nie verstehen. Und ich will es auch nicht verstehen. Aber da du nun schon zurückgekehrt bist, wirst du tun, was ich dir sage, und dich in der nächsten Woche auf dem Ball der Randells sehen lassen. Du wirst tanzen und dich unterhalten, und sie werden sehen, dass du nicht verrückt bist.“
Verzweifelt schüttelte Henry den Kopf. Das konnte er nicht, auf keinen Fall.
„Aber ich bin verrückt“, stieß er hervor. „In meinen Gedanken geschehen immer wieder all die Dinge, die längst Vergangenheit sind, und ich weiß nicht, wie ich überhaupt mit diesen Erinnerungen leben soll.“
Der Earl richtete sich auf und beugte sich nach vorn, sodass er plötzlich sehr viel größer wirkte.
„Dann wäre es besser gewesen, du wärst gar nicht erst zurückgekommen.“
Fassungslos starrte Henry in die kalten Augen des Mannes, der sein Vater war. Dann wandte er sich ab. Alle Kraft hatte ihn verlassen und mühsam schleppte er sich zur Tür.
„Du gehst zu diesem Ball“, rief der Earl noch hinter ihm her, aber Henry machte sich nicht die Mühe zu antworten. Es war sinnlos.
Vergeblich hatte er am Nachmittag noch versucht, sich auf dem Bett ein wenig auszuruhen. Die Worte des Earls hallten in seinem Inneren nach.
Das Schlimmste daran war, dass er ihm recht geben musste. Wie oft hatte er schon den Umstand verflucht, dass er das Martyrium der französischen Gefangenschaft überlebt hatte, dass er all diese guten Männer hatte sterben sehen und selbst nicht gestorben war. Bilder von seinen toten Soldaten tauchten aus seiner Erinnerung auf, obwohl er versuchte, sie beiseite zu schieben.
Mit der zusammengekrampften Faust hieb er auf seinen Oberschenkel und der Schmerz brachte ihn zurück in die Gegenwart. Das alles zu beenden wäre leicht, ein Pistolenschuss, und es wäre vorbei.
Auch wenn er es sich an manchen Tagen verzweifelt wünschte, er konnte es nicht. Er war nicht imstande, sich einfach aus diesem verhassten Leben zu verabschieden, denn das hatten sie ihm beim Militär tatsächlich beigebracht: Disziplin.
Jeder hatte eine Aufgabe, und Fahnenflucht war keine Möglichkeit, die in Betracht kam. So versuchte er, sich seiner Aufgabe zu stellen, so gut es eben ging.
Er erhob sich und trat zum Waschtisch, füllte Wasser aus dem Krug in die flache Schüssel und zog sein Hemd aus. Diese alltäglichen und automatischen Tätigkeiten gaben ihm Halt und Sicherheit, und er wünschte sich nichts weiter, als seine Ruhe zu haben. Sich in Gesellschaft zu bewegen, erschien ihm an manchen Tagen ebenso schwierig, wie über ein Schlachtfeld zu laufen. Ständig drohte die Gefahr, dass er angerempelt wurde und vollkommen unangemessen reagierte.
Bereits zwei Mal hatte er in einer schnellen und präzisen Bewegung jemanden niedergestreckt, der ihm zur Begrüßung von hinten auf die Schulter geklopft hatte.
Sein Blick in den Spiegel zeigte ihm die kantigen Gesichtszüge, die zusammengepressten Lippen und die wirren langen Haare, die ihn wie einen Straßenräuber aussehen ließen. Er war gefährlich und unberechenbar, das wussten inzwischen alle und hielten entsprechenden Abstand.
Trotzdem versuchte er immer wieder, dem Anspruch des Earls gerecht zu werden. Er hoffte verzweifelt, dass die Probleme mit der Zeit nachlassen würden, dass diese Anfälle, bei denen er nicht mehr Herr seiner Handlungen war, irgendwann aufhörten.
Zu verbergen, wie schwer ihm das alles fiel, und die Angst vor seinen eigenen Dämonen hinter einer Maske zu verstecken, war ihm schon zu einer Gewohnheit geworden. Er war entschlossen, die Geister der Vergangenheit niederzukämpfen und wieder zu dem Mann zu werden, der er vor dem Krieg gewesen war. Er würde das schaffen, ganz gleich, was es ihn kostete.
Energisch läutete er nach seinem Kammerdiener. Dieser erschien sofort, um ihn für den Abend noch einmal zu rasieren. Nachdem seine Haare zu dem üblichen strengen Zopf nach hinten gebunden waren und seine makellose Kleidung die Narben auf Brust und Rücken verbarg, fühlte er sich der kommenden Aufgabe etwas besser gewachsen.
Das Dinner bei Lord Sutton lag ihm schon wie ein Stein im Magen, ehe er es gegessen hatte. Es war nicht eines dieser kleinen, privaten Treffen, die er gelernt hatte zu ertragen. Dies war die Feier zur Geburt des Stammhalters, und es würden sehr viel mehr Gäste kommen, als ihm angenehm waren. Dieses Mal hatte es allerdings keinen Zweck, sich zu sträuben.
Seufzend ergab er sich in sein Schicksal und schritt langsam die Treppe hinunter, ließ sich Mantel, Dreispitz und den für Herren des Adels unvermeidlichen Degen geben und trat nach draußen.
Er konnte diesen Abend nicht absagen – seinen Freunden zuliebe. Und diese waren nicht eben zahlreich gesät. Die einzigen Menschen, die ihm nahestanden, hatte er erst nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft kennengelernt. Doktor Charles Morehill wäre da sicher der Erste, der ihm einfiel. Der wunderbaren und warmherzigen Lady Diana Derenham, die ja nun Lady Redgrave, Baroness Ampton, war, hatte er immerhin sogar sein Leben zu verdanken. Dem Ehemann von Lady Diana, Mithras Redgrave, Baron Ampton, hatte er als Vertrauten dazu geschenkt bekommen. Auch wenn der große, düster wirkende Mann auf den ersten Blick abweisend wirkte, war er ein sehr intelligenter Mann und sehr loyal.
Sie würden alle da sein, und ein wenig war er auch stolz, diese Leute als Freunde bezeichnen zu dürfen.
Sie waren alle etwas ungewöhnlich, jeder auf seine spezielle Art, und manchmal gefiel ihm der Gedanke, er wäre ihnen ein bisschen ähnlich. Zumindest den Umstand, nicht in die sogenannte gute Gesellschaft richtig hineinzupassen, teilte er sich mit ihnen, allerdings war er nicht sicher, ob dieser Gedanke ihm ebenfalls gefiel.
Heute würden aber auch viele fremde Menschen da sein, und das störte ihn erheblich. Nur unter seinen Freunden hatte er das Gefühl, akzeptiert und willkommen zu sein, sogar mit seinen seltsamen Verhaltensweisen, deren wahres Ausmaß nur Doktor Morehill kannte.
Inzwischen hatte seine Kutsche angehalten und der Fahrer öffnete den Schlag. Eilig stieg er aus und musste sich zwingen, vor der geschwungenen Freitreppe einen gemäßigten Schritt zu halten. Die Angewohnheit, vor seinen nächtlichen Dämonen – im wahrsten Wortsinne – davonzulaufen, hatte dazu geführt, dass er dazu neigte, sich zu hastig zu bewegen, und dadurch wie gejagt und wenig kultiviert wirkte. In Gesellschaft zwang er sich daher stets zu äußerer Ruhe, auch wenn es in seinem Inneren brodelte.
Am Ende der Treppe angekommen betätigte er den schweren Türklopfer, und schon nach wenigen Augenblicken wurde ihm geöffnet. Mithras und Diana waren offensichtlich gerade erst angekommen und standen noch in der imposanten Eingangshalle. Die Götter nannte er die beiden gern im Scherz, da sie die Vornamen römischer Gottheiten trugen. Diana war ja als Göttin der Jagd durchaus bekannt, aber nur wenige wussten, dass Mithras unter den Römern als Sonnengott gegolten hatte. So hatte diese scherzhafte Bezeichnung seiner beiden besten Freunde etwas Vertrautes und Persönliches.
Der Butler nahm ihm Mantel, Hut und Degen ab, und als Diana sich zur Tür herumdrehte, strahlte sie über das ganze Gesicht.
„Henry, wie schön, dass du auch schon so früh da bist.“
„Oh, bei den Göttern!“, stöhnte er laut und alle drei lachten herzlich.
Diana kam auf ihn zu und schenkte ihm ganz undamenhaft eine schwesterliche Umarmung. Das war so gerade noch mit der Schicklichkeit zu vereinbaren, denn immerhin war sie auch seine Cousine.
Mithras hingegen legte seine riesige Pranke auf Henrys Schulter und nickte kurz.
„Henry, gut dass du gekommen bist.“
Verwundert hob er die Brauen, denn es hatte natürlich außer Frage gestanden, dass er diesen Anlass nicht versäumen würde.
„Du weißt schon, an solchen Abenden entsteht schnell ein bedenklicher Frauenüberschuss. Der Doktor hatte einen Notfall und kommt möglicherweise gar nicht mehr. Da bin ich froh, dass ich wenigstens dich noch hier habe, zwischen den ganzen, ahem, edlen Damen.“
Bei seinen letzten Worten hatte Diana sich mit einem Grinsen zu ihrem Gatten umgedreht und nun stieß sie ihm neckend den Ellenbogen in die Rippen.
Er schmunzelte, schaute liebevoll auf sie herunter und legte den Arm um ihre Schultern.
Dass es in Gesellschaft selbst für Ehepaare als unschicklich angesehen wurde, sich so vertraut zu berühren, hatte die beiden noch nie davon abgehalten, ihre Zuneigung offen zu zeigen.
Zu Henry gewandt verkündete Diana mit einem frechen Grinsen:
„Na, das ist ja gerade so noch mal gut gegangen. Ich möchte gar nicht wissen, was er eigentlich sagen wollte.“
Henrys Lächeln fiel etwas verkrampft aus. Wie immer, wenn er die beiden so liebevoll und vertraut miteinander umgehen sah, zog etwas in seiner Brust, dem er nicht auf den Grund gehen wollte. Sein Leben war wirklich kompliziert genug, auch ohne eine Frau an seiner Seite. Obschon sein Vater eine Ehefrau für unverzichtbar hielt, hatte er sich damit abgefunden, sein Leben allein zu verbringen. Natürlich musste er sich darüber auch gar keine Gedanken machen, denn der Ruf eines peinlichen Verrückten erledigte dieses Problem recht gründlich. Keine Dame der Gesellschaft würde auch nur seine nähere Bekanntschaft machen wollen, geschweige denn seine Ehefrau werden.
Mit immer noch dem gleichen gezwungenen Lächeln wandte er sich dem Salon zu, in dem sich inzwischen eine ansehnliche Gesellschaft versammelt hatte.
Diana drehte sich zu ihm zurück, weil sie offensichtlich noch etwas sagen wollte, starrte dann aber an ihm vorbei, bevor sie ganz herumfuhr und wieder zur Eingangstür zurücklief.
„Mein Gott, Sophia, ich glaube es ja gar nicht. Ich hätte dich beinahe nicht erkannt“, rief sie voller Freude.
Mithras blieb in seiner ganzen Größe vor ihm in der Tür stehen, und so war Henry gezwungen, sich ebenfalls umzudrehen und die neu Ankommende zu begrüßen.
Eine dunkelhaarige Dame, deutlich kleiner als die recht große Diana und auch deutlich zurückhaltender, stand in ihrem rauchgrauen Kleid im Eingang und lächelte scheu. Ihre Erscheinung war von solch zurückhaltender Eleganz und unaufdringlicher Schönheit, dass Henry für einen Augenblick die Luft wegblieb.
Nachdem Diana sie begrüßt hatte, griff sie nach ihrer Hand und zog sie hinter sich her zu den beiden Männern.
„Sophia, das ist mein Mann Mithras, Baron Ampton. Mithras, darf ich dir Sophia Thomas vorstellen, eine sehr gute Freundin aus Great Yarmouth. Und dies ist unser guter Freund Lord Henry Camerden. Henry, meine Freundin Sophia Thomas.“ Sie stockte, als suchte sie nach Worten, dann musste sie herzlich lachen. „Ich rede ja kompletten Unsinn. Du heißt natürlich gar nicht mehr Thomas, ich habe mich wohl immer noch nicht daran gewöhnt.“
Mit einem schüchternen Lächeln neigte die Dame den Kopf und kam Diana zuvor.
„Baroness Wilson.“
Henry nahm ihre behandschuhten Finger und beugte sich vor, um einen Handkuss anzudeuten. Er stand so dicht vor ihr, dass er glaubte, ihre Wärme spüren zu können, und ihr zarter Rosenduft schien ihn noch näher zu ihr heranzuziehen. „Lady Wilson, es ist mir ein Vergnügen.“
Bis jetzt hatte sie den Blick gesenkt gehalten, doch als er sich wieder aufrichtete, sah sie ihn an und ein warmer Glanz trat in ihre Augen. Er empfand eine ungewöhnliche Vertrautheit, so als würden sie sich bereits länger kennen und hätten irgendeine verborgene Gemeinsamkeit. Dieser erstaunliche Eindruck verschwand leider wieder, als er ihre Hand loslassen musste. Nur ein wenig klang es noch nach in der Andeutung eines Lächelns, das eher in ihren Augen zu erkennen war als um ihren Mund. Dann wandte sie sich ab, begrüßte Mithras und folgte Diana in den Salon.
Er stand noch einen Augenblick wie gebannt da und versuchte dieses Gefühl festzuhalten, aber es war mit ihr verschwunden. Ernüchtert folgte er ihr und wurde sofort von Lord Sutton begrüßt.
„Camerden, mein Lieber. Schön, dass Sie da sind. Würden Sie einen Whisky mit mir nehmen, während die Damen den Stammhalter bewundern? Als Junggeselle wird die Begutachtung eines Babys ja nicht unbedingt auf Ihr größtes Interesse treffen.“
Henry warf Sutton einen verständnisvollen Blick zu, ließ sich einen Whisky reichen und hörte sich dann an, was der stolze Vater alles über seinen Sohn zu berichten wusste. Inzwischen kamen weitere Gäste an und der frischgebackene Vater verabschiedete sich, um die Neuankömmlinge zu begrüßen.
Henry versuchte sich am Rand des Raumes aufzuhalten, sodass niemand ihn unvermittelt von hinten anstoßen konnte oder er Gefahr lief, von mehreren Personen umringt zu werden. Immer wieder hielt er Ausschau nach Lady Wilson, doch sie war stets in Gespräche mit anderen Damen verwickelt, sodass er sich ihr nicht nähern konnte, ohne unhöflich zu wirken.
Schließlich wurde es Zeit, dass sich die Gesellschaft nach nebenan begab, um an der langen Tafel Platz zu nehmen. Auch Mithras und Diana schienen verschwunden, und das, obwohl der riesige Kerl in einer Menschenansammlung eigentlich nicht zu übersehen war.
Im Speisezimmer, das tatsächlich eher ein Speisesaal war, stand plötzlich Doktor Morehill neben ihm. Erfreut begrüßte er den Mann, der ihn nach seiner Rückkehr aus dem Kriegsgebiet zumindest körperlich wieder zusammengeflickt hatte und inzwischen ebenfalls zu einem guten Freund geworden war.
Die Tischordnung sah vor, dass der Doktor auf seiner linken Seite sitzen sollte, und die Götter tauchten, in ein Gespräch vertieft, ihm gegenüber am Tisch auf. Gerade wollte er sich setzen, als ihm bewusst wurde, dass die Baroness auf seiner rechten Seite stand. Mit einem erfreuten Lächeln drehte er sich zu ihr herum, verbeugte sich und zog ihr den Stuhl heraus.
„Lady Wilson, es ist mir eine Ehre, neben Ihnen Platz nehmen zu dürfen.“ Einen Augenblick lang wunderte er sich selbst über den rauchigen Klang seiner Stimme.
Als die Lady seine Worte mit einem stillen Nicken und einem kaum sichtbaren Lächeln quittierte, schienen ihre Wärme und ihr Rosenduft wieder zu ihm herüberzufließen, und sein Herzschlag beschleunigte sich ganz unvernünftig. Er musste dringend etwas Abstand gewinnen und so rief er sich in Erinnerung, dass diese faszinierende Lady ja verheiratet war.
„Sie sind heute Abend ohne Begleitung. Ist Lord Wilson heute verhindert?“
Warum hatte er das nur gefragt? Es passierte ihm doch sonst nicht, dass er irgendetwas sagte, ohne sich vorher jedes Wort genauestens zu überlegen.
Noch ehe er sich darüber klar werden konnte, hörte er ihr Lachen. Soweit er sie bis jetzt erlebt hatte, schien das ein geradezu euphorischer Gefühlsausbruch zu sein.
Auch Diana sah erstaunt auf und ihr Blick schien ihn zu fragen, wie er das denn angestellt hätte. Das Lachen der Baroness klang erstaunlich voll und doch leise – und in diesem Augenblick wünschte er sich, am heutigen Abend noch öfter in diesen Genuss zu kommen.
„Der Baron ist ganz außerordentlich verhindert, und das nicht nur heute Abend. Er wurde vor genau acht Monaten und fünf Tagen erschossen.“
Henry zuckte zusammen und zugleich machte sein Herz einen kleinen Freudensprung.
Sie war Witwe.
Wie konnte er Freude empfinden bei der Erkenntnis, dass ihr Mann tot war? Im selben Moment verabscheute er sich dafür. „Das tut mir sehr leid, Mylady.“
Keineswegs spürte er auch nur einen Anflug von Bedauern und bemerkte erst jetzt verwundert, dass Lady Wilson gelacht hatte, als sie über den Tod ihres Gatten gesprochen hatte.
„Mir nicht“, flüsterte sie, während sie sich leicht zu ihm hinüberbeugte.
Er starrte sie mit aufgerissenen Augen an. „Wie bitte?“
Sie zuckte mit den Schultern. „Er wurde in einem Duell erschossen. Er hat die Ehefrau eines anderen Mannes als seine Mätresse ausgegeben und er hat das Duell nur verloren, weil er mal wieder sturzbetrunken war. Eigentlich war er ein guter Schütze und er hat in den Monaten zuvor bereits drei ehrenwerte Männer aus ähnlichen Gründen getötet. Nein, es tut mir nicht leid, nicht im Mindesten.“
Henry holte tief Luft und musste sich sehr zusammenreißen, damit ihm nicht der Unterkiefer herunterklappte. Sie sah ihn fragend von der Seite an. „Diana hat Sie als guten Freund vorgestellt, ich dachte, da wären Sie es gewohnt, wenn man die Dinge sagt, wie sie sind, anstatt wie ein Politiker drum herumzureden.“
Er hatte seine Gesichtszüge inzwischen wieder unter Kontrolle und nickte nur schweigend. Am Rande bemerkte er, dass der erste Gang aufgetragen wurde und Lady Wilson sich mit der gegenübersitzenden Diana weiter unterhielt. Währenddessen versuchte er sich vorzustellen, wie die Ehe mit einem Mann ausgesehen hatte, der sich offen mehrere Mätressen gehalten und sich andauernd deswegen duelliert hatte, außerdem ständig betrunken gewesen war. Vielleicht war es tatsächlich eine große Erleichterung gewesen, ihn loszuwerden.
Lord Sutton sprach irgendeinen Toast aus und alle hoben die Gläser. Als sein Glas sacht das von Lady Wilson berührte und sie dabei wieder lächelte, fühlte es sich beinahe an, als hätte er sie direkt berührt. Ihre Nähe verwirrte ihn und fühlte sich doch gleichzeitig auch angenehm an.
Doktor Morehill sprach mit seinem Nachbarn auf der anderen Seite und auch Diana und Mithras waren im Gespräch vertieft, sodass Henry während des weiteren Dinners Gelegenheit hatte, sich mit Lady Wilson zu unterhalten. Er war angenehm überrascht, da sie sich weniger für den aktuellen Klatsch und mehr für Politik und Kunst interessierte. Sie hatte zu den aktuellen politischen Themen eine deutliche Meinung und war erstaunlich belesen. Insgesamt hatte er den Eindruck, dass man Lady Wilson sogar als Blaustrumpf bezeichnen könnte, wäre sie auf der anderen Seite nicht so zurückhaltend und still. Mit ihrer Direktheit und ihrem hintergründigen Humor brachte sie ihn mehrmals zum Lachen, und er musste zugeben, dass er sich schon sehr lange nicht mehr so entspannt und gutgelaunt unterhalten hatte.
Ein lauter Knall. Direkt hinter ihm.
Innerhalb von Sekundenbruchteilen wurde er in die Vergangenheit katapultiert.
Der Pistolenschuss hallte wieder und wieder durch seinen Kopf und die Gesichter der Exekutierten verschwammen vor seinen Augen.
Sein Puls raste, sein Körper verkrampfte und namenloses Grauen schnürte seinen Hals zu.
Er wusste nicht, wie lange es gedauert hatte, bis er begann, seine Umgebung wieder wahrzunehmen. Völlig außer Fassung fand er sich auf dem Boden vor seinem Stuhl kniend wieder. Hitze schoss in seinen Kopf, als ihm klar wurde, was geschehen war. Er machte sich gerade wieder einmal abgrundtief lächerlich und alle Anwesenden wurden in ihrer Einschätzung bestätigt, dass er nicht mehr ganz bei Sinnen war.
Obwohl seine Gedanken langsam zur Realität des Dinnerabends zurückfanden, konnte er seinen Körper nicht dazu bringen, sich zu erheben.
Eine schmale Hand legte sich auf seine Schulter, und er bemerkte, dass etwas Glitzerndes unmittelbar vor ihm auf dem Boden lag. Die Hand übte leichten Druck aus und der Daumen fuhr sacht an seinem Hals auf und ab. Zitternd und mit wahnwitzig rasendem Herzschlag hockte er noch immer auf den Knien und versuchte, sich auf diese kleine Bewegung zu konzentrieren. Er hob seine Schulter diesem Druck entgegen, der ihm Halt und Sicherheit gab.
„Und, können Sie meinen Ohrring finden, Baron Camerden? Ich bin ganz sicher, dass ich ihn noch trug, als wir uns zum Dinner setzten. Es ist ein Erbstück meiner Mutter, müssen Sie wissen, und hat große Bedeutung für mich. Es wäre ja ganz fürchterlich, wenn ich ihn verloren hätte, das hätte meine Mutter mir nie verziehen.“
Sie fuhr fort, über ihre verstorbene Mutter und die Wichtigkeit des Schmuckstücks zu sprechen, während er allmählich seinen Körper wieder unter Kontrolle brachte. Fahrig griff er nach dem Ohrring und richtete sich auf. Ein warmer Blick aus ihren waldgrünen Augen zog ihn förmlich hoch, als er ihr den Ohrring reichte.
„Oh, wie wunderbar. Sie haben ihn gefunden.“ Sie hielt seine Hand mit dem Schmuckstück einen Augenblick fest und fügte hinzu: „Wie freundlich von Ihnen, für meine Ungeschicklichkeit geradezustehen und Ihr Dessert zu unterbrechen. Vielen Dank, mein lieber Camerden, Sie haben mich wirklich gerettet.“
Inzwischen hatte er sich bereits auf den Stuhl gleiten lassen und bemühte sich um ein ungezwungenes Lächeln in die Runde.
„Ich bitte Sie, liebe Lady Wilson, das war doch nicht der Rede wert“, antwortete er mit einem Nicken. Die Festigkeit seiner Stimme überraschte ihn selbst, wenn man bedachte, was vor wenigen Augenblicken geschehen war. Seine Hände zitterten immer noch als Nachwirkung von der Attacke und er war ausgesprochen dankbar, dass sie ihre Hand auf seinen Arm legte. Ihre Berührung gab ihm einen festen Punkt, an dem sein aufgewühlter Geist sich halten konnte.
Das Schmuckstück lag nun neben seiner Hand auf dem Tisch und er fixierte es fest, während er mit einigen gemessenen Atemzügen seinen Körper zur Ruhe zwang, so wie der Doktor es ihm erklärt hatte.
Baron Sutton erhob sich nur wenige Augenblicke nach dem Zwischenfall und bat die Herren in den Rauchsalon. Damit war das Dinner offiziell beendet, und auch alle anderen Gäste erhoben sich. Henry stand ebenfalls auf, musste aber feststellen, dass seine Beine ihn kaum trugen und er keineswegs sicher war, laufen zu können, ohne wie ein Betrunkener zu wanken.