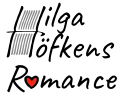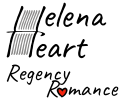Akhmal gibt es als
Ebook, Taschenbuch und Hardcover.
signiertes Taschenbuch oder Hardcover kaufen
Eine lange Leseprobe findest du unten auf dieser Seite.

Ein Mensch, ein Bastard und ein Akhmal – können sie den Krieg zwischen den Arten aufhalten?
Malina muss gemeinsam mit ihrem Bruder Kalev regieren. Der schürt jedoch den Krieg zwischen den Menschen und den katzenhaften Akhmal, denn so will er zum größten Herrscher aller Zeit aufsteigen.
Der Gesandte der Akhmal kommt unerwartet in die Hauptstadt. Er erhofft Hilfe gegen eine heimtückische Krankheit der Akhmal, doch Kalev hat andere Pläne. Malina muss sich für eine Seite entscheiden. Sie rettet sein Leben und stellt sich damit offen gegen ihren Bruder. Kalev nutzt die Gelegenheit, sie in den Kerker werfen zu lassen.
Ein Akhmalbastard ist durch Malinas Schuld ebenfalls dort gefangen, und ausgerechnet er ist ihre einzige Hoffnung auf Rettung.
Leseprobe von "Akhmal - Der Aufbruch"
Kapitel 1 Veränderungen
Kälte und Feuchtigkeit wurden vom Wind durch die zahllosen Ritzen des Bretterverschlages getrieben und sein Fell wärmte ihn kaum. Auch wenn der heutige Tag wieder sehr warm gewesen war, so waren die Nächte noch immer eisig. Zitternd lag er in der hintersten Ecke des Verschlages und versuchte, sich so gut es ging, in seine einzige Decke zu wickeln. Wenn er doch nur dieses lose Brett noch etwas weiter zur Seite schieben könnte. Er drehte sich um und zerrte wieder daran, doch seine Muskeln waren steif vor Kälte und er hatte einfach keine Kraft mehr. Wenn er nach nebenan gelangen könnte, würde er sich zwischen die warmen Körper der Ziegen drängeln und müsste nicht so erbärmlich frieren. Vielleicht hätte auch eine der Ziegen noch ein wenig Milch, träumte er weiter, und sein leerer Magen rumorte schmerzhaft bei dem Gedanken.
Natürlich war das einer der Gründe, dass er immer nachts hier eingesperrt war. Die Ziegenmilch war nicht für ihn und beim Melken morgen würde auffallen, dass er sich davon genommen hatte. Hunger und Kälte waren schon immer Teil seines Lebens gewesen, aber als Bastard hatte er sicher auch nichts anderes zu erwarten.
Er ließ von dem Brett ab und richtete sich auf. Unruhe breitete sich in ihm aus, denn irgendetwas geschah draußen. Er konnte es weder hören noch wittern, und doch war er völlig sicher, dass im nächsten Moment etwas Furchtbares geschehen würde. Seine Hände zitterten jetzt nicht mehr nur vor Kälte, sondern auch vor Anspannung, und ganz von selbst fuhr er die Krallen aus. Mit starr nach vorne gerichteten Schnurrhaaren kroch er zur Außenwand und spähte durch das Astloch. Seine Sinne waren schärfer als die der Menschen, aufgrund dessen, was er war.
Nicht so gut wie die seines Akhmalvaters, aber deutlich besser als die seiner Menschenmutter. Er hatte von fast allem die Hälfte bekommen und das machte ihn zu nichts. Er war weniger als nichts, denn er gehörte Sjardok, wie das Vieh nebenan. Im Gegensatz zu den Ziegen und Kühen hatte er aber nicht einmal einen richtigen Namen, mit dem man ihn rufen konnte. Kein stolzer Akhmal würde sich jemals mit einem wie ihm abgeben. Auch die Menschen hatten nie mehr in ihm gesehen als ein nützliches Tier, obwohl sie die Akhmal niemals als Tiere bezeichnen würden.
Natürlich hatte er nicht wirklich viele Erfahrungen mit Akhmal oder Menschen sammeln können, denn fast sein ganzes bisheriges Leben hatte er in diesem Verschlag im Stall verbracht. Er wusste nicht wirklich, was Akhmal waren. Er hatte nur von ihnen reden gehört. Was er kannte, waren Menschen. Sjardok, seine Mutter und die anderen Frauen, die hier lebten. Nur sehr selten ließ eine der Frauen sich dazu herab, das Wort an ihn zu richten. Aus dem, was er von ihren Gesprächen hörte, hatte er sich jedoch schon vieles über die Welt zusammengereimt.
Jetzt hörte er die Hufschläge mehrerer Pferde. Sie waren allerdings noch nicht auf dem Innenhof angekommen, als die Geräusche plötzlich stoppten.
Er presste sein Gesicht gegen das Holz, um durch das Astloch besser sehen zu können, und tatsächlich erkannte er Schatten, die durch das Eingangstor huschten. Die schnell ziehenden Wolken schoben sich immer wieder vor die halbe Scheibe des Mondes, so dass ein Schattenspiel entstand, das den gesamten Innenhof in bewegtes Licht tauchte. Einen Moment lang war er nicht sicher, ob er tatsächlich etwas gesehen hatte, aber dann witterte er sie. Menschen. Sie rochen anders, fremd, und ein Schauer aus Aufregung und Angst richtete sein Rückenfell auf. Eine der Frauen schrie auf und dann drangen viele Schreie, Schluchzen und gemurmelte Flüche von Männern an sein Ohr.
Als nächstes sah er Sjardok, der mit wehendem Umhang aus seinem Wohnhaus stürzte und zu den Frauengemächern eilte. Von der anderen Seite des Hofes näherte sich ein Schatten und direkt vor seinem Verschlag trafen die beiden aufeinander.
„Seid Ihr Sjardok, der Magier, dem dies alles gehört?“, fragte eine fremde Stimme.
„Jawohl, der bin ich. Gebt Euch zu erkennen. Warum dringt ihr mitten in der Nacht in meinen Hof ein. Ich verlange zu wissen, wer Ihr seid.“
„Die Regentin schickt uns. Wir nehmen Euch hiermit fest“, ertönte wieder die fremde Stimme. Er hörte, wie eine Klinge gezogen wurde, und plötzlich fiel helles Mondlicht auf Sjardok und den Angreifer. Der Mann hielt einen Dolch an Sjardoks Kehle, doch der versuchte, ihm die Waffe zu entwinden. Ein kurzes Gerangel folgte, dann schrie der Magier auf, sackte zu Boden und der andere Mann entfernte sich.
Mit rasendem Herzschlag saß er hinter der dünnen Holzwand und starrte auf die verzerrte Fratze seines Besitzers. Die starren, weit aufgerissenen Augen schienen den Himmel anzuklagen. Ein dünnes Rinnsal lief an seinem Hals hinab und mischte sich mit dem schmutzigen Wasser am Boden. Er roch das Blut und die Witterung des Menschen, der Sjardok ermordet hatte. Er wollte fliehen, aber natürlich konnte er nirgendwohin. Starr vor Angst hockte er also nur da und versuchte die weiteren Vorgänge im Hof zu erkennen.
Im Mondschein sah er, wie mehrere Männer die Frauen aus der Hütte holten und sie auf einen Wagen steigen ließen.
Einer der Kerle kam in seine Richtung. „Lass uns hier auch nachsehen. Wenn Vieh da ist, nehmen wir das am besten mit.“ Ein zweiter Mann löste sich aus der Gruppe und folgte dem Ersten. Die Stalltür knarrte in den Angeln. „Ah, Ziegen, sehr gut. Und was haben wir hier?“ Am Riegel seines Verschlages wurde gerüttelt, der Mann fluchte. Dann splitterte das Holz und die Tür flog auf.
Entsetzt riss der Kerl die Augen auf und taumelte mehrere Schritte zurück. „Bei Akhim, was ist das denn?“
Vor Angst vollkommen erstarrt, presste er sich an die Wand des Verschlages und wagte kaum zu atmen. Er wusste ja, dass er furchtbar aussah. Sein Fell war verfilzt und was einmal Kleidung gewesen war, bestand nur noch aus Lumpen.
Ein anderer Mann spähte in den Verschlag und schüttelte fassungslos den Kopf. „Goldener Himmel, was haben die denn mit dem Akhmal gemacht? Der sieht ja aus wie ein … warte mal.“ Er trat näher. „Das ist gar kein Akhmal, das ist ein … ein Bastard.“ Er spuckte auf den Boden und sein Gesicht zeigte Abscheu und Ekel. „Bei Akhim, dass es das gibt. Unnatürlich sowas. Dieser Magier war wirklich irre. Was solls, schnapp ihn dir Ferno.“ Mit einer Handbewegung unterstrich er seine Anweisung und einer der Männer, die sich inzwischen vor der Tür versammelt hatten, trat näher.
Er erkannte den Kerl, der Sjardok getötet hatte, und ohne nachzudenken fuhr er die Krallen aus und zeigte die Zähne.
Der Mann zog blitzschnell das Messer. „Soll ich ihn nicht lieber gleich töten? Der macht doch nur Ärger.“
„Nein, nimm ihn mit. Der geht in den Kerker, wird bestimmt ein guter Kämpfer. Oder kommst du mit dem etwa nicht klar?“
Der Mann vor ihm presste die Lippen zusammen und seine Augen wurden schmal. „Ein Angriff Bürschchen, und ich kann für nichts garantieren. Hände nach vorn.“
Es kostete ihn ungeheure Willenskraft, die Krallen einzuziehen, aber er schaffte es und streckte beide Arme vor.
Mit einer schnellen Bewegung schnürte der Mann seine Hände zusammen und dann zerrte er unwirsch am Ende des Seils. „Hoch mit dir, aber keine hektische Bewegung, sonst … “ Mit einer eindeutigen Geste zog er den Daumen über seine eigene Kehle.
Sehr langsam erhob er sich und nickte, dann riss der Mann so heftig am Seil, dass er wieder auf die Knie fiel. „Komm jetzt, du Biest.“
Sie brachten ihn zum Wagen und verschnürten ihn mit mehreren Seilen, so dass er sich kaum noch bewegen konnte. Das Gesicht an die Wand gedrückt lag er zwischen den Frauen. Sie versuchten, so weit wie möglich von ihm wegzukommen, aber um Abstand zu halten gab es nicht genug Platz. Sofort begann eine darüber zu zetern, wie dreckig sein Fell war und wie abstoßend und unnatürlich er aussah. Müde schloss er die Augen und versuchte, auch seinen Geist vor den Beschimpfungen zu verschließen, während der Wagen sich polternd in Bewegung setzte. Dann spürte er plötzlich eine warme Hand und ein vorsichtiges Streichen an seinem Rücken. Überrascht riss er die Augen auf und holte tief Luft. Für einen Augenblick stoppte die Bewegung und er verfluchte sich dafür, dass er so unüberlegt reagiert hatte, aber dann streichelte die Hand weiter. Gebannt hielt er den Atem an, damit diese freundliche und sanfte Berührung nicht wieder verschwinden würde. Dann versuchte er, sehr vorsichtig und langsam, den Kopf zu drehen, um die Frau zu sehen, die hinter ihm saß. Sein Rücken berührte ihre angezogenen Beine und die Arme hatte sie um die Knie geschlungen. Wie die anderen trug sie ein dunkles Kleid. Mit gesenktem Kopf hockte sie da und schien von ihrer Umgebung keine Notiz zu nehmen. Die offenen Haare fielen nach vorn, sodass er ihr Gesicht nicht erkennen konnte. Sehr zaghaft bewegte er sich und versuchte, seinen Rücken ganz leicht gegen ihre Hand zu drücken.
Den ganzen Weg lang strich sie sanft über das Fell an seinem Rücken und er genoss dieses wunderbare Streicheln so sehr, dass er beinahe alles andere darüber vergaß. Erst als sie angekommen waren und alle Frauen vom Wagen stiegen, hob sie den Kopf. Ihre nussbraunen Haare fielen zurück und mit strahlend blauen Augen sah sie ihn an. Diese Augen erinnerten ihn sofort an seine Mutter, und auch ihre Gesichtszüge schienen ihr ähnlich zu sein.
„Wer bist du?“, flüsterte er heiser.
Ein kleines Lächeln umspielte ihren Mund, dann antwortete sie ebenso leise „Familie“, bevor sie sich abwandte und den anderen folgte. Er wollte etwas sagen, ihre Freundlichkeit erwidern, ihren Namen erfahren, aber sofort zerrte jemand an seinen Fesseln. Er spürte, wie er erst über die Bodenplanken rutschte und dann in den Dreck fiel. Der Aufprall presste die Luft aus seinen Lungen, und einen Moment lang rang er nach Atem. Jemand zerrte an den Stricken und schließlich konnte er die Beine wieder bewegen.
„Hoch mit dir, sonst helf ich nach.“ Eine Peitsche zog einen Striemen über seine Brust, noch ehe er auf den Befehl reagieren konnte. Erschrocken krümmte er sich zusammen, dann sprang er auf.
„Na geht doch. Ab ins Loch mit dir, da lang.“ Der Mann stieß ihn vor sich her durch eine große Tür, hinter der tiefe Finsternis herrschte. Dies war also der Kerker.
* * *
Malina erschrak, als ihr Bruder die Tür zum Speisesaal aufriss und in der üblichen selbstbewussten Art eines Herrschers in den Raum stolzierte. Mit einem Grinsen nahm er ihr gegenüber Platz und sie ahnte Schlimmes. Wenn er diesen Ausdruck trug, bedeutete es, dass die Dinge so liefen, wie er es sich vorgestellt hatte. Meist war dies das Gegenteil von dem, was sie selbst sich gewünscht hätte.
Sie zwang sich dazu, entspannt sitzen zu bleiben, und hob demonstrativ ihren Weinkelch zum Mund, als würde sein Auftritt sie nicht im Mindesten beeindrucken.
„Die Akhmal kommen“, verkündete er.
Malina verschluckte sich an dem Wein und prustete ihn beinahe über den Tisch.
Kalev lachte laut. „Na das nenn ich mal Freude, meine liebe Schwester. Leider kommen nur wenige. Ein Gesandter des Reganto und sein Gefolge. Die Streitmacht haben sie noch zu Hause gelassen.“
Erleichtert ließ Malina sich gegen die Lehne ihres Stuhles sinken. Ein Gesandter, na das ging ja noch. Sie hatte einen Moment lang befürchtet, die Kriegstreiberei ihres Bruders hätte nun endgültig dazu geführt, dass die Akhmal ein Heer gegen die Hauptstadt geschickt hätten. Seit Vater gestorben war und ihnen gemeinsam das Regierungsrecht übertragen hatte, waren die Spannungen zwischen ihr und ihrem Bruder ins Unerträgliche angewachsen. Fast in jeder Hinsicht waren sie verschiedener Meinung und Malina befürchtete inzwischen, dass Kalev die Macht endgültig an sich reißen und sie einfach absetzen würde.
„Du sagst gar nichts dazu. Freust du dich denn nicht? Sonst bist du doch immer auf der Seite der Akhmal, wenn sie mal wieder unsere Grenzen angreifen. Sie werden noch einen Krieg vom Zaun brechen. Ich bin sicher, dass der Gesandte nur zum spionieren kommen will, aber er wird schon sehen, was er davon hat. Ja ja, das wird er schon sehen.“
„Nicht die Akhmal brechen einen Krieg vom Zaun, Kalev.“ In dem Moment, als sie es sagte, verfluchte sie ihre schnelle Zunge bereits. Er hatte sie provozieren wollen, und sie war bereitwillig in seine Falle getappt. Resigniert schloss sie einen Augenblick die Augen und atmete durch. Sie konnte in jeder Lage ruhig und diplomatisch sein, wie es ihrer Aufgabe als Regentin entsprach. Nur ihr Bruder schaffte es stets, sie mit wenigen Worten aus der Fassung zu bringen. „Wir werden die Gesandten gebührend empfangen, Kalev. Und wir werden ihnen nicht bereits Spionage unterstellen, noch ehe sie unsere Stadt betreten haben.“ Ihre Stimme hatte ruhig und bestimmt geklungen, obwohl sie sich keineswegs so fühlte.
Ihr Bruder hob seinen Weinkelch und prostete ihr zu. „Die Gesandten kommen erst übermorgen an, aber um das Volk darauf einzustimmen, werden wir am Vortag den Bastard noch einmal kämpfen lassen.“ Er grinste, als er ihren fragenden Gesichtsausdruck sah. „Nicht wahr, du wusstest, dass es Sjardok gelungen ist, einen Bastard zu züchten.“
Malina schüttelte den Kopf. Sie verstand den Zusammenhang zwischen dem verrückten Magier, den Gesandten und den Käfigkämpfen nicht. „Es gibt ein Kind?“, fragte sie.
„Nein, meine Liebe, einen erwachsenen Mann. Es muss direkt im ersten Jahr seiner Versuche geschehen sein. Meine Männer konnten es auch kaum glauben. Leider gibt es nur den Einen.“
Malina musste sich zusammenreißen, um nicht aufzuspringen. Das durfte doch wohl nicht wahr sein, dass dieser Irre mit seinen furchtbaren Experimenten Erfolg gehabt hatte. „Ich will ihn sehen“, brachte sie mühsam beherrscht hervor.
Kalev schüttelte energisch den Kopf. „Auf keinen Fall vor dem Kampf. Er ist widernatürlich. Es darf solche wie ihn nicht geben. Höchstens als Attraktion im Käfigkampf kann er eine Zeit lang herhalten, aber über kurz oder lang muss er sterben.“ Ihr Bruder schüttelte sich angeekelt, als sie über den Bastard sprachen.
„Nein Kalev, das kannst du nicht machen. Es ist doch nicht seine Schuld, was dieser Magier da getan hat. Er hat es sicher nicht verdient, wie ein gemeiner Verbrecher behandelt zu werden. Außerdem ist er als halber Akhmal sicher ziemlich kräftig. Er wird sich nicht so leicht von einem Menschen oder einer Raubkatze besiegen lassen.“
„Da hast du völlig recht. Ich habe ihn gesehen, ein prächtiger Bursche. Nachtschwarzes Fell und ordentlich groß, wenn auch etwas mager. Er hat sogar schon mehrmals erfolgreich im Käfig gekämpft. Wir werden ihn also in Zukunft hungern lassen. Viel ist ja eh nicht an ihm dran, so dass er bald ausgezehrt genug sein wird, damit ein Krieger oder ein Löwe ihn töten kann.“ Kalev lachte auf. „Inzwischen wird er das Volk unterhalten und so ist diese Missgeburt immerhin noch zu etwas nütze. Er ist ja schließlich etwas Neues und Besonderes und die Massen lieben es.“ Wieder lachte er auf und ihr wurde übel bei dem Gedanken daran, dass er diese Käfigkämpfe tatsächlich genoss.
Verurteilte Schwerverbrecher von Raubkatzen töten zu lassen, hatte eine lange Tradition in ihrer Gesellschaft. Die Katzen waren Akhims heilige Tiere, denn auch der Gott selbst hatte die Gestalt einer schneeweißen Katze. So überließ man die Vollstreckung des Todesurteils quasi ihm persönlich. Früher hatte man die Verurteilten nackt und unbewaffnet in die Katzengrube gestoßen. Meist wurden sie bereits durch den Sturz so schwer verletzt, dass sie wehrlos waren und mehrere hungrige Katzen ihnen dann ein schnelles Ende machten. Aber ihr Bruder hatte mit den Käfigkämpfen ein sehr beliebtes Publikumsspektakel daraus gemacht, bei dem die Verurteilten bewaffnet waren und es ihnen manchmal sogar gelang, das Raubtier zu töten. Wenn das geschah, bekam der Kämpfer einen Monat Aufschub, ehe er wieder antreten musste. Häufig erkrankten die Verletzten jedoch an Wundfieber, und beim zweiten Kampf waren sie kaum noch imstande, sich zu wehren. Da die Zahl der in Gefangenschaft gehaltenen Katzen mit der Zeit zurückgegangen war, ließ Kalev neuerdings die Verurteilten auch gegeneinander antreten. Sie wurden gezwungen, so lange zu kämpfen, bis einer von ihnen tot war. Manchmal erlitt selbst der Sieger so schwere Verletzungen, dass er in den folgenden Tagen daran starb.
Diese Art, die Verurteilten zu quälen, war so viel grausamer als der schnelle Tod in der Grube. Die Sensation, die der Käfigkampf für das Publikum bedeutete, war ihrem Bruder Grund genug, und ein mitfühlendes Herz hatte er noch nie besessen.
Nahrungsmittelknappheit und hohe Steuern hatten das Volk unzufrieden gemacht. Es wurde immer schwerer, die Unruhen im Zaum zu halten, und der wöchentliche Kampf im Käfig brachte, zumindest den Bewohnern der Hauptstadt, Ablenkung von ihren eigenen Problemen. Jeder der es wagte, sich gegen das Herrscherhaus auszusprechen, wurde eingekerkert und zum Käfigkampf verurteilt. So diente der Käfig ihrem Bruder nicht nur dazu, das Volk zu unterhalten. Er führte ihnen auch drastisch vor, was mit denen geschah, die sich gegen ihn wandten.
Malina sprang von ihrem Stuhl auf und fuhr ihren Bruder an. „Bei Akhim! Du kannst ihn doch nicht auch noch wochenlang quälen, ehe du ihn tötest. Das darfst du nicht tun, er hat doch gar nichts verbrochen.“
Ihr Bruder schüttelte den Kopf und sah missbilligend quer über den Tisch zu ihr hinüber. „Er existiert und ist allein dadurch eine genauso große Bedrohung für unsere Gesellschaft wie jeder dieser Mörder, Diebe und Unruhestifter. Es wird schon nicht allzu lange dauern. Auch ein halber Akhmal lebt nicht ewig.“
Malina zitterte beinahe vor Wut und sie warf die Arme in die Luft, als ob sie ihrem Bruder an die Kehle gehen wollte. „Du bist ja verrückt. Er ist doch nur ein Geschöpf, das auch leben will. Bei Akhim, er ist doch ein halber Mensch und er hat gar nichts verbrochen. Wie kannst du das nur tun?“
Kalevs Augen funkelten, er trat zwei Schritte vor und stand wieder so dicht vor Malina, dass sie zu ihm hochschauen musste. Drohend beugte er sich vor. „Sehr einfach, liebe Schwester, weil ich die Macht habe, es zu tun.“
„Nein Kalev, ich werde das nicht zulassen. Du überschreitest deine Befugnisse. Wir sollen gemeinsam die Geschicke des Landes lenken, das hat unser Vater nicht ohne Grund so bestimmt. Du kannst das nicht ohne meine Zustimmung tun.“
Sie wich einen Schritt zurück, doch ihr Bruder baute sich wieder direkt vor ihr auf, und seine Stimme wurde plötzlich bedrohlich leise. „So langsam reicht es mir. Nichts, aber auch gar nichts kann ich ohne deine Zustimmung tun. Ich denke, unser Vater war bereits senil, als er das bestimmte. So kann man kein Land führen, schon gar nicht, wenn es auf einen Krieg zusteuert.“
Malinas ganzer Körper bebte vor Wut, und sie ballte die Hände zu Fäusten. Aber sie wusste, wann sie sich geschlagen geben musste. Auch wenn es ihr widerstrebte, musste sie behutsam mit dem Temperament ihres Bruders umgehen, wenn sie keinen Bürgerkrieg auslösen wollte. Schon die wachsende Bedrohung durch einen Krieg gegen die Akhmal war gefährlich genug, ohne dass sich die Herrschergeschwister auch noch zerstritten.
Mit verächtlichem Schnauben wandte sie sich von ihrem selbstgefälligen Bruder ab und begann, über andere Möglichkeiten nachzudenken.
* * *
Schritte näherten sich aus dem dunklen Gang, der zu seinem Kerker führte. Wenige Augenblicke später konnte er auch den flackernden Lichtschein erkennen, den die Öllampe der Wachen aussandte. Schritte bedeuteten, dass sie Wasser und manchmal auch Essen brachten. Natürlich brachten sie auch die Peitsche, denn es schien ihnen eine gewisse Freude zu bereiten, wenn er brüllte und versuchte, sich von der Kette loszureißen. Trotzdem war er jedes Mal erleichtert, wenn jemand kam. Auch wenn es nur für einen kurzen Augenblick war, so versprachen die Schritte Licht und damit Erlösung von der undurchdringlichen Dunkelheit.
Er konnte nichts sehen, gar nichts, so finster war es. Nur fühlen konnte er. Den Boden aus festgetretener Erde, der bereits eine Kuhle gebildet hatte, an der Stelle, wo er immer lag. Die rauen Steinwände, die manchmal den Eindruck erweckten, sie würden näherkommen, obwohl er sie doch gar nicht sah.
Den Eisenring an seinem Handgelenk fühlte er auf besonders schmerzhafte Art. Die Kette, die ihn an die Mauer fesselte, war gerade lang genug, dass er zwei Schritte in jede Richtung gehen konnte. Zuerst hatte er daran gezerrt und versucht, die Fessel abzustreifen, aber inzwischen konnte er nur noch dasitzen und versuchen, den Arm mit dem Eisenring so wenig wie möglich zu bewegen. Beim ersten Mal, als der Wärter die Peitsche gebraucht hatte, war sein Fell aufgerissen als er so weit nach hinten gesprungen war, wie die Kette reichte. Seitdem wurde die Wunde immer größer, denn das Eisen saß fest um sein Handgelenk und rieb die Haut immer weiter auf. Seitdem jagte jede kleine Bewegung des Metalls auf seinem offenen Fleisch einen brennenden Schmerz durch den ganzen Arm.
Und riechen, das konnte er auch. Moderiger, stickiger Geruch war ihm schon entgegengeschlagen, als sie ihn zum ersten Mal in dieses Loch gestoßen hatten. Und es war nicht besser geworden durch seine eigenen Ausscheidungen, die er in dem festen Boden nur unzureichend vergraben konnte. Er konnte sich inzwischen kaum noch selbst ertragen, da er natürlich auch keine Möglichkeit hatte sich zu waschen, und sein empfindsamer Geruchssinn war in eine Art Stumpfheit geflohen. Auch Hunger war sein ständiger Begleiter, aber den hatte er sein ganzes bisheriges Leben auch schon gekannt.
Es war die tiefe Schwärze, die den Kerker zu einem wahren Albtraum machte. Sie erdrückte ihn und raubte ihm die Lebenskraft, daher war ihm alles recht, was diesen entsetzlichen Zustand für einen Augenblick vertrieb.
Es gab nichts, das ihm hier unten das Verstreichen der Zeit verraten hätte, es wurde nicht heller oder dunkler. Nur die gelegentlichen Schreie oder ein heiseres Stöhnen aus der Richtung des Ganges verrieten ihm, dass es irgendwo in der undurchdringlichen Finsternis noch andere Gefangene gab.
Stets kamen die gleichen beiden Männer und obwohl er die Peitsche fürchtete, sehnte er sich auch nach dem Licht, dem Wasser und dem Essen, das sie brachten.
Einige Male hatten sie ihn auch zu einem Kampf geholt und das bedeutete eine gewisse Zeit außerhalb des Kerkers, frische Luft und Licht. Sonne schien auf ihn herab, wenn er Glück hatte, doch auch Regen war ihm recht, denn der spülte immerhin den Gestank des Kerkers aus seinem Fell. Beim letzten Mal musste er lange draußen stehen und auf seinen Kampf warten. Die Sonne hatte auf ihn herabgebrannt, und die Hitze war unerträglich gewesen, aber Schatten oder Wasser waren anderen Kämpfern vorbehalten. Er hatte angekettet an der Wand zu stehen wie ein wildes Tier. Und trotzdem war er froh darüber, wenn er hier herausdurfte. Er sehnte sich geradezu nach dem Licht der Sonnenwärme und dem frischen Lufthauch, der ihn ab und an streifte, wenn er draußen war.
Die Kämpfe im Käfig waren bis jetzt glimpflich für ihn ausgegangen. Ganz gleich, ob er gegen Menschen oder Tiere kämpfte, er hatte sie alle besiegt. Besiegt und getötet natürlich, denn er brachte es nicht über sich, seine Gegner am Leben zu lassen.
Eigentlich hätte er durch die Übung und die körperliche Anstrengung besser werden müssen. Da er aber nur sehr wenig Essen bekam, zehrte ihn der Mangel an Nahrung immer mehr aus und er wurde von Kampf zu Kampf kraftloser. Schwäche konnte er sich nicht leisten, denn wenn er schwach war, würde er sterben, so viel war sicher.
Die Schritte kamen näher und seine Augen saugten gierig das Licht der kleinen Lampe auf. Soweit die Eisenfessel es ihm gestattete, schob er sich nach vorn zum Gitter, um jeden Augenblick des wertvollen Lichts auszukosten. Er hatte vor kurzer Zeit bereits gekämpft. Obwohl nichts, außer der Erschöpfung seines Körpers, ihm verriet, wie viel Zeit inzwischen vergangen war, war er doch sicher, dass sie ihn nicht schon wieder holten. Warum sie gekommen waren, konnte er sich nicht vorstellen, aber es war nicht wichtig. Wichtig war nur, dass das Licht ihn für einige Augenblicke davon erlöste, in der Dunkelheit und Verzweiflung zu versinken.
Die beiden Wachen waren jetzt am Gitter angekommen und quietschend drehte sich der Schlüssel, dann wurde die Tür aufgestoßen und schlug mit einem Krachen gegen die Wand.
„Bastard!“, brüllte der größere der beiden Wachen heiser zu ihm herüber. Das war der Name, den sie schon immer für ihn benutzt hatten. Es war der einzige Name, den er je gehabt hatte.
„Bastard, verzieh dich in deine Ecke, sonst schmeckst du die Peitsche.“
Ein Zischen fuhr durch die Luft, als der Wächter den dünnen Lederriemen auf ihn heruntersausen ließ, ohne ihm auch nur eine Möglichkeit zu geben, dem Befehl nachzukommen. Ein scharfer Schmerz schoss quer über sein Gesicht und an seinem Arm hinab, dann hatte er plötzlich das Gefühl, seine Hand würde abgerissen. Das Ende der Peitsche hatte sich in der Kette verfangen. Als der Wärter daran zerrte, um sie zu lösen, schnitt sich die Eisenfessel tief in die entzündete Wunde seines Handgelenks. Ein schmerzvolles Brüllen drang aus seiner Kehle, noch bevor er richtig verstand, was geschehen war.
„Dir werd ich’s zeigen, mich auch noch anzubrüllen!“, schrie der Mann und er konnte das leichte Zittern in seiner Stimme hören.
Er wusste, dass der Kerl Angst vor ihm hatte und die Peitsche einsetzte, um ihn auf Abstand zu halten. Er ließ sie gleich noch dreimal herabzischen, doch obwohl die gerade erst verschorften Stellen auf seiner Brust sofort wieder aufrissen, drang jetzt kein Schmerzenslaut mehr über seine Lippen. Als beim dritten Schlag wieder das Leder in der Kette hängen blieb und wieder der Schmerz wie Feuer seinen Arm hinauffuhr, drang ein tiefes Stöhnen zwischen seinen zusammengebissenen Zähnen hindurch. Dann griff Dunkelheit nach seinem Bewusstsein und er spürte nichts mehr.
* * *
Malina saß vor ihrem Spiegel, sah aber nicht hinein, sondern starrte vor sich hin. Heute würde der Gesandte ankommen und sie schwankte zwischen Vorfreude und leichter Panik. Sie bewunderte die Akhmal für ihre Eleganz, die farbenreiche Sprache und bis vor Kurzem hatte sie auch die Politik ihres Herrschers gutgeheißen. Reganto war der korrekte Titel. Der alte Reganto hatte allerdings abgedankt, und was sie bisher von seinem Sohn gehört hatte, klang nicht besonders gut. Das wahre Problem in den Beziehungen zwischen Akhmal und Menschen saß allerdings hier im Palast und schürte die Feindschaft mit fingierten Überfällen.
Mit einem Seufzen erhob sie sich, um zum Frühstück ihrem Bruder Gesellschaft zu leisten. In dem Moment öffnete sich die Tür und ihre Zofe erschien.
„Herrin, ich muss Euch etwas mitteilen, das ich von meinem Bruder erfahren habe.“ Sie hielt dabei den Blick starr auf den Boden gerichtet und flüsterte so leise, dass Malina sie kaum verstand.
„Was denn? Sprich doch lauter“, verlangte sie.
Mit zusammengepressten Lippen schüttelte das Mädchen den Kopf und zog ein Gesicht, als würde sie am liebsten im Erdboden verschwinden. „Das kann ich nicht. Mein Bruder darf es niemals erfahren“, flüsterte sie. „Er ist dem Herrscher treu ergeben, und wenn er erfährt, was ich Euch sage, dann wird er mich, oh er wird …“ Sie verstummte und schlug die Hände vor den Mund.
„Himmel, was hat mein Bruder nun wieder für abwegige Pläne?“, fragte Malina genervt, aber leise. Dies war nicht das erste Mal, dass sie durch ihre Zofe, deren Bruder ein Leibdiener von Kalev war, von dessen Plänen erfuhr.
„Er wird ihn umbringen. Er wird sie alle umbringen. Oh Herrin, ihr müsst etwas tun“, wimmerte Malinas Zofe und berichtete ihr dann alle Einzelheiten des perfiden Plans ihres Bruders.
Wenig später betrat sie den Speisesaal. Kalev blickte ihr entgegen und schien in bester Stimmung zu sein.
„Guten Morgen, liebe Schwester. Ist es nicht ein guter Morgen?“
„Ja Kalev, das ist es. Ich freue mich auf den Besuch, den wir heute bekommen.“ Sie zwang ein Lächeln auf ihr Gesicht, obwohl sie das Gefühl hatte, dass er ihre Miene durchschaute.
Sein Grinsen wurde breiter. „Bald werden wir die Berge von Monto Ceno zu unserem Gebiet zählen können. Ich weiß, dass du den Krieg verabscheust, aber es wird der hungernden Bevölkerung helfen. Du bist doch immer so weichherzig, eine Frau eben. Es muss dich doch freuen, dass die fruchtbaren Täler und fischreichen Gewässer bald uns gehören. Nicht wahr?“
Malina blieb neben dem Tisch stehen, denn auf diese Art musste sie endlich einmal nicht zu ihm aufsehen. „Nein, Krieg ist nie ein guter Weg. Das hat auch gar nichts mit Weichherzigkeit zu tun.“ Sie rang um Beherrschung. Schon wieder hatte er sie mit wenigen Worten in Rage gebracht. „Die Bevölkerung hungert, weil die Ernte nicht eingebracht wird. Die Männer sind in der Armee, statt auf den Feldern. Außerdem kostet der ganze Kriegsapparat zu viel. Die Bauern haben kaum Geld für Saatgut, und du presst sie seit Jahren immer weiter aus.“
Kalev lachte. Fassungslos sah Malina ihn an.
Er schüttelte den Kopf. „Natürlich müssen auch meine Soldaten essen, aber das Volk versteht das. Sie werden mich feiern, und die Abgaben sollten natürlich nach unserem Sieg wieder geringer werden. Meine Gefolgsleute in den Provinzen werden mit Achtung nach Cefurbo schauen, denn ich werde der Herrscher mit dem größten Gebiet seit Menschengedenken sein. Jawohl, so wird es sein“ Er nickte selbstgefällig und wandte sich seinem gut gefüllten Teller zu.
Malina begann, vor dem Tisch auf und ab zu laufen. All das hatte sie schon viel zu oft gehört, aber es wurde davon nicht wahrer. Sie wusste genau, dass die Berge von Monto Ceno nur der Anfang wären. Immer weiter würde er in Akhmalgebiet eindringen und das ganze Land mit Krieg überziehen. „Auch Handel und das Zusammenleben von Menschen und Akhmal würden Wohlstand bringen. Außerdem …“
Kalev unterbrach sie und wedelte unwirsch mit einer Hand, während er kaute und in der anderen Hand den Weinkelch hielt. „Handel, ja natürlich. Die Akhmal stopfen sich die Taschen voll, und wir können froh sein, nicht zu verhungern. So stellst du dir das vor? Wohlstand bringt das nur denen, nicht uns.“
Malina wollte etwas sagen, aber angesichts seiner Arroganz schloss sie den Mund wieder. Er saß vor dem gefüllten Teller, dem reich gedeckten Tisch und all den vergoldeten Kelchen und Schalen, und dann sprach er von verhungern.
Er nippte an seinem Kelch und stach mit der Gabel in der Luft herum, während er weitersprach. „Diese überheblichen Katzen müssen dringend einmal eine Lektion erteilt bekommen. Wir werden sie bis zu ihrer goldenen Hauptstadt treiben. Dann wollen wir doch einmal sehen, welche Art die mächtigere ist. Jawohl, das werden wir dann sehen.“
Woher kam nur all diese Arroganz? Malina wusste, dass es keinen Zweck mehr hatte, über diese Dinge weiter zu diskutieren, denn das hatten sie schon hundert Mal getan. Also nahm sie ohne ein weiteres Wort am anderen Ende des Tisches Platz und kaute lustlos auf einem Stück Brot herum. Ihr war der Appetit vergangen. Sie musste einen Weg finden, Kalev aufzuhalten. Leider war das Kräfteverhältnis zwischen ihnen ungleich verteilt, denn das Militär stand hinter ihrem Bruder. Sie konnte nicht viel ausrichten, aber sie weigerte sich, sich damit abzufinden.
Kapitel zwei Begegnungen
Am Nachmittag traf der Gesandte ein. Wie es dem Protokoll entsprach, wurden ihm und seinem Gefolge Räume im Gästeflügel zugewiesen. Dann bekamen sie zunächst die Gelegenheit, sich von den Strapazen der Reise zu erholen, ehe der erste Empfang am folgenden Tag stattfinden würde. Von den Bediensteten erfuhr Malina, dass es sich um Argon, einen Verwandten des Königshauses der Akhmal handelte, und dass er nur mit zwei Leibwächtern und einigen Trägern reiste. Ihre Sorgen um seine Sicherheit wuchsen angesichts der heimtückischen Pläne ihres Bruders. Ihre Zofe hatte sehr genau berichtet, was Kalev geplant hatte. Er wollte den Gesandten und sein ganzes Gefolge in einen Hinterhalt locken und töten. Anschließend wollte er ihm eine Provokation unterstellen, die durch eine unglückliche Verkettung der Umstände zum Tod der Akhmal geführt hätte.
Malina wusste, dass schon am zweiten Tag des Besuches das Unheil seinen Lauf nehmen sollte. So sah sie sich gezwungen, noch heute Abend wie eine Verschwörerin, zu den Unterkünften der Gäste zu schleichen. Natürlich hatte Kalev Wachen vor dem Eingang zum nördlichen Gästeflügel postiert. Angeblich war er ja so sehr um die Sicherheit der Gäste besorgt. Doch Malina war klar, dass es eher darum ging, sie unter Kontrolle zu halten, damit sie nicht ungehindert im Palast herumspazierten. Also musste sie die Männer ihres Bruders unbedingt umgehen, damit er von ihrem Besuch nichts erfuhr. Mit Hilfe der Geheimgänge in diesem uralten Gemäuer war es für sie kein Problem, an jeder beliebigen Stelle des Palastes zu verschwinden, um dann in einem anderen Bereich wieder aufzutauchen.
Lauschend stand sie einen Augenblick hinter der Geheimtür, bis sie sicher war, dass niemand sie bemerken würde. Dann schlüpfte sie schnell hinaus, schlug den Wandteppich, der die Tür verbarg, zur Seite und trat in den Flur, von dem die zahlreichen Gästesuiten abgingen. Mit hoch erhobenem Kopf und selbstbewusst gestrafften Schultern trat sie vor die zweiflügelige Tür der Zimmerflucht, die speziell für die Akhmal umgestaltet worden war. Falls sie doch noch jemand hier sah, musste es wirken, als wäre sie ganz selbstverständlich und offiziell in diesem Bereich des Palastes.
Ein Diener der Akhmal, mit glänzend schwarzem Fell und aufmerksam nach vorn gerichteten Ohren, öffnete ihr. Seine sparsame, doch bunte Kleidung war reich bestickt und lag eng an, sodass sie wirkte, als wäre sie eins mit dem Fell. Seine großen dunklen Augen sahen mit unverhohlener Überheblichkeit auf sie herunter. Obwohl sie für eine Frau recht groß war, reichte sie ihm nicht einmal bis zur Schulter, und unwillkürlich war sie einen Schritt zurückgetreten, um ihn überhaupt richtig ansehen zu können. Seine Schnurrhaare zuckten nach vorn, als sie ihm direkt ins Gesicht schaute. Die kleinen Ohren verrieten durch ihre hektischen Bewegungen, dass er seine Aufmerksamkeit zwischen ihr und dem Raum hinter ihm, zu teilen versuchte.
Sie schob die Schultern nach hinten, hob das Kinn und lächelte freundlich. „Guten Abend. Ich bin Malina, die Mitregentin und Schwester des Herrschers Kalev. Wäre es wohl möglich, dass ich den Gesandten Argon sprechen kann?“ Sie gab sich Mühe, mit ihrem besten, gehobenem Akhmal. Schon als Kind hatte sie die Sprache als Teil ihres Politikunterrichts gelernt, aber nur selten Gelegenheit gehabt, sie anzuwenden. Daher hatte sie sich die Sätze zuvor gut zurechtgelegt, und vor dem Spiegel ein wenig geübt, bis sie meinte, das Gefühl für die eigenartige Sprachmelodie wieder ausreichend präsent zu haben.
Der Angesprochene strich mit einer Hand seine Schnurrhaare zurück und richtete sich noch ein wenig mehr auf, ehe er antwortete. „Wir wissen, wer Ihr seid, allerdings denken wir nicht, dass der Gesandte heute Abend noch Besuch empfängt. Ihr solltet morgen beim offiziellen Essen mit ihm sprechen können.“
Malina schluckte. Noch nie hatte ein Bediensteter es gewagt, sie so rundheraus abzuweisen. Sie hatte auch seinen Tonfall gut genug verstanden, um den überheblichen Unterton herauszuhören. Ärger wallte in ihr auf, trotzdem musste sie sich zusammenreißen, denn Unfreundlichkeit hätte sie ihrem Ziel nicht nähergebracht. Also setzte sie ein breites Lächeln auf, zeigte dabei wie unabsichtlich ein klein wenig die Zähne, und stellte noch einmal fest: „Es ist wirklich von äußerster Dringlichkeit und ich fürchte, diese Angelegenheit kann auf keinen Fall bis morgen warten.“
Die Augen des Dieners wurden zu Schlitzen, als er sichtbar vor der Drohung, die das Zeigen der Zähne bedeutete, zurückzuckte. Dann wandte er den Blick ab und Malina glaubte für einen Moment, bereits gewonnen zu haben. Im nächsten Augenblick spannten sich Ohren und Gesichtszüge jedoch wieder und er widersprach entschieden. „Nichts kann so dringlich sein, dass der Gesandte deswegen heute Abend noch gestört werden dürfte. Das Protokoll sieht es auch gar nicht vor, dass der Gesandte sich mit einer Frau trifft.“ Sie konnte sehen, dass seine Nackenhaare sich ein wenig aufgestellt hatten und sein Schwanz nervös hin und her peitschte. Auch sein Tonfall war aggressiv und die knurrenden Zwischentöne zwischen den Worten waren überdeutlich. Es wäre gar nicht mehr nötig gewesen, aber er zog am Ende des Satzes noch ein klein wenig die Lippe hoch, sodass die Eckzähne kurz aufblitzten. Bei dem Wort ‚Frau‘ triefte seine Stimme förmlich vor Abscheu. Malina ärgerte sich unglaublich über diese Arroganz. Aber vor allem hoffte sie, dass Argon selbst nicht zu der konservativen Gruppe Akhmal gehörte, bei denen Frauen noch immer als Lebewesen ohne eigene Rechte betrachtet wurden.
Gerade setzte sie zu einer Erwiderung an, als ein leises, aber kehliges Knurren den Diener zusammenfahren ließ. Das Wort in dem Knurren verstand Malina nicht, aber die Bedeutung war ohnehin klar.
Mit einer geschmeidigen Bewegung trat der schwarze Bedienstete zur Seite und verbeugte sich tief. Schnell musterte Malina den Gesandten, den sie bisher noch nicht zu Gesicht bekommen hatte. Seine hoch aufragende und muskulöse Gestalt wirkte mit dem goldbraunen Fell wie eine in Traminz gehauene Statue des Gottes Akhim. Die knappe Weste strahlte kobaltblau und trug neben den aufwändigen Stickereien sogar kleine Edelsteinsplitter und Holzperlen in einem verwirrenden Muster. Ihr blieb kurz die Luft weg, als er sie mit seinen strahlenden grünen Augen aufmerksam musterte. Für einen Augenblick beschlich sie tatsächlich das Gefühl, Akhims Abbild aus dem Tempel der Weissagung würde vor ihr stehen.
„Mein Herr, es liegt nur ein Missverständnis vor. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung“, brachte der erschrockene Diener unterwürfig hervor.
Inzwischen hatte Malina Zeit, sich wieder auf ihre Botschaft zu konzentrieren. Hastig schloss sie ihre Lippen und achtete sorgfältig darauf, trotz des Lächelns, die Zähne verborgen zu halten. Mit einer tiefen Verbeugung wandte sie sich dem Gesandten zu, doch noch ehe sie etwas sagen konnte, richtete er sein Wort an sie.
„Hoheit, es ist mir ein Vergnügen, Euch heute Abend begrüßen zu dürfen. Euer Besuch freut mich außerordentlich, denn ich hatte ohnehin geplant, einige Dinge unter vier Augen mit Euch zu besprechen.“ Seine Stimme klang tief und melodisch, ganz anders als der kratzige Ton des Dieners. Den Worten folgte ein kurzes, freundliches Schnurren und eine einladende Handbewegung.
Malina versuchte, sich ihre Überraschung über die freundliche Begrüßung nicht anmerken zu lassen, und folgte seiner Aufforderung einzutreten. Wieder einmal bewunderte sie die Art der Akhmalsprache, durch den Tonfall und die zusätzlichen Laute so viel mehr auszudrücken, als die reinen Worte es taten.
Er trat mit einer eleganten Bewegung zur Seite, während er weiter sprach. „Ich muss mich für das abweisende Verhalten meines Dieners entschuldigen. Leider verursacht unser Auftreten unter den Menschen, die unsere Art nicht kennen, oft Irritation. Ich möchte Euch bitten, das nicht persönlich zu nehmen. Er hat es sicherlich nicht so gemeint.“
Auch wenn der Gesandte ausgesprochen höflich war und Malina wusste, dass sie besser eine Faust in der Tasche machen sollte, konnte sie die herablassende Art seines Dieners nicht unkommentiert lassen.
„Oh, ich bin sicher, insbesondere den letzten Satz hat er ganz genau so gemeint. Doch ich bin auch sicher, dass nicht alle Akhmal diese Ansicht über Frauen teilen.“ Das Lächeln auf ihrem Gesicht fühlte sich falsch an, angesichts der Wut, die in ihr brodelte. Ihre Worte waren allerdings diplomatisch sehr ungeschickt. Malina wusste das genau, aber manchmal konnte sie ihre Zunge einfach nicht zurückhalten.